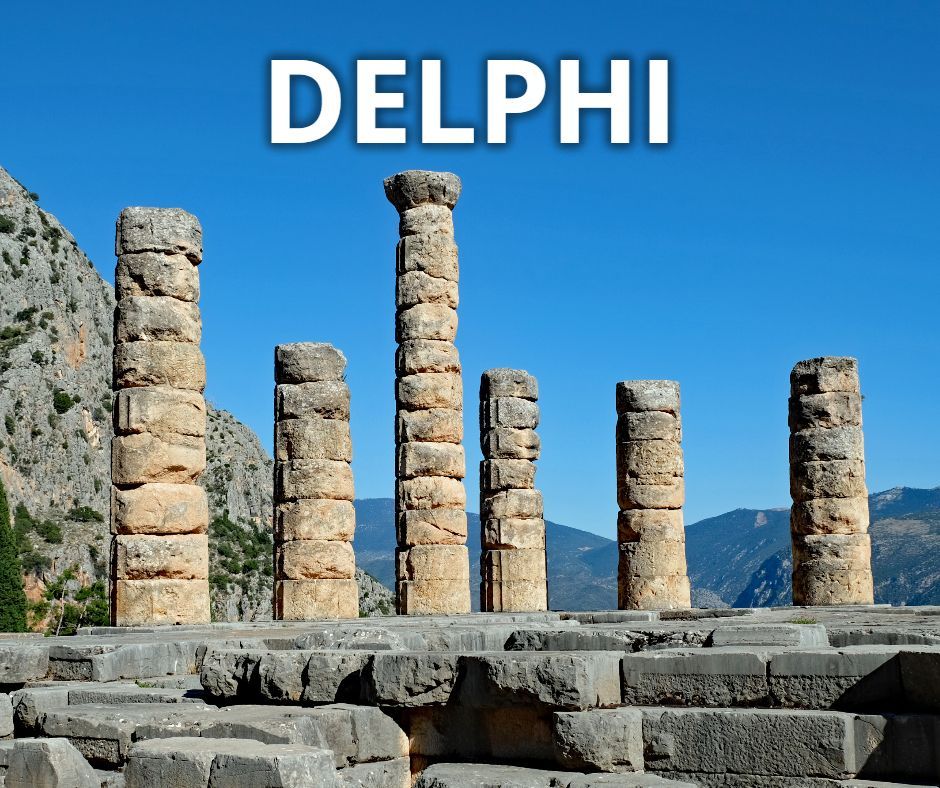Die Startanlage bestand aus hölzernen Pflöcken mit Sperrseilen, die durch einen raffinierten Mechanismus blitzschnell gegen den Boden geklappt werden konnten. © Bild: Wikimedia Commons
Das Zeusheiligtum und das antike Stadion in Nemea

Nemea war zwar kein klassisches Ziel der Grand Tour, zog aber dennoch immer wieder gebildete Reisende an. Bereits um 1675/76 reisten Jacob Spon und George Wheler durch die Region, auch wenn ein gesicherter Nachweis fehlt, dass sie den Zeus-Tempel von Nemea tatsächlich besuchten. Erst im Jahr 1766 beschrieb Richard Chandler im Auftrag der Society of Dilettanti den mächtigen, wenn auch schon verfallenen Tempel ausführlich und setzte seine Beobachtungen mit antiken Quellen in Beziehung. Etwa um 1800 hielten Edward Dodwell und Otto Magnus von Stackelberg die Ruinen mit detailreichen Zeichnungen fest, während William Martin Leake 1805 das Heiligtum sorgfältig vermaß und kartierte. Später beschrieb er in seinen Travels in the Morea auch das Stadion und die Badeanlagen. Der französische Diplomat François Pouqueville verlieh den Stätten in seinen Berichten einen poetischen Charakter und verband sie mit den alten Mythen, wodurch Nemea auch literarisch lebendig wurde.
Zweifellos war der um 350 – 330 v. Chr. über einem zerstörten Vorgängerbau aus dem 6. Jh. v. Chr. errichtete Tempel des Zeus die Hauptattraktion des Heiligtums. Obwohl nach dem Verbot aller heidnischen Aktivitäten durch Kaiser Theodosius im Jahre 453 n. Chr. die systematische Zerstörung des Tempels begann, haben drei der aufrecht stehenden Säulen allen Zerstörungen getrotzt. Unter Verwendung der zahlreichen, weit im Gelände verstreut liegenden Säulentrommeln und Trümmerteile wird die Anlage nach und nach weiter rekonstruiert. (Die Bilder zeigen die Situation im Jahr 2021.)
In Nemea, berühmt als Stätte, an der der griechischen Mythologie zufolge Herakles den Nemeischen Löwen erwürgte, fanden seit 573 v. Chr. alle zwei Jahre im Sommer zu Ehren des Zeus panhellenische Spiele statt. Der etwa 25 Kilometer südwestlich von Korinth gelegene, in einer einsamen Hügellandschaft gelegene Ort eignete sich wegen seiner günstigen Lage ideal als Austragungsort eines der vier großen panhellenischen Spiele. Bereits im 5. Jahrhundert v. Chr., als Argos zeitweise die Austragung der Spiele übernahm – die zum Gedenken an den tragischen Tod des Opheltes abgehalten wurden –, wurden in Nemea ein erster Zeustempel und ein Heroon für den von einer Schlange getöteten Sohn des Priesterkönigs Lykurgos errichtet. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. wurde das Heiligtum zerstört, und die Spiele fanden in der Folgezeit in Argos statt.
Ab etwa 330 v. Chr. kehrten die Spiele nach Nemea zurück, was vermutlich mit der panhellenischen Politik der Makedonier zusammenhing. Zugleich wurde der Zeus-Tempel neu errichtet – eines der ersten Bauwerke, das alle drei klassischen griechischen Architekturordnungen (dorisch, ionisch, korinthisch) vereinte. Außerdem entstanden mehrere praktische Nebengebäude sowie ein neues Stadion. Im Jahr 271 v. Chr. wurden die Spiele erneut nach Argos verlegt, und das Heiligtum von Nemea wurde nach und nach aufgegeben.
Der Tempel des Zeus

Der Tempel des Zeus in Nemea wurde in einem schlichten dorischen Stil mit 6 × 12 Außensäulen errichtet und misst etwa 22 × 44 Meter. Auf ein Opisthodom (Rückhalle, symmetrisch zum Pronaos) wurde bewusst verzichtet; stattdessen ist die Eingangsseite besonders großzügig gestaltet. Die Säulenstellung in der Cella ist zweigeschossig: Im unteren Bereich finden sich korinthische Säulen, darüber Pilaster mit vorgesetzten ionischen Halbsäulen. Damit zählt der Tempel zu den ersten Bauwerken, die alle drei klassischen griechischen Architekturordnungen – dorisch, ionisch und korinthisch – in sich vereinen. Im hinteren Teil der Cella befindet sich ein abgetrennter Raum, ähnlich einem Adyton, zu dem eine Treppe hinabführt. Möglicherweise handelt es sich dabei um das Grab des Opheltes, doch könnte dieser abgeschlossene Bereich auch als Orakelstätte gedient haben. Vor dem Tempel liegt ein 40 Meter langer Altar, an dem die Athleten vor dem Betreten des rund 450 Meter südöstlich gelegenen Stadions ihre Opfer darbrachten.
Der gesamte Stufenbau samt großer Teile der Orthostatenzone der Cella sind erhalten geblieben. (Die unterste Wandschicht bezeichnet man als Orthostatenschicht, die einzelnen, präzise bearbeiteten Steine dieser Schicht werden Orthostaten genannt. Hier sind sie waagrecht gesetzt, die Orthostatenschicht ist zweireihig ausgeführt.)
Der vertiefte Kultraum, der möglicherweise als Orakelstätte diente
Vor dem Tempel befand sich der 40 m lange Altar, an dem die Athleten vor den Wettkämpfen ihre Opfer darbrachten.
In frühchristlicher Zeit (Ende des 4. - 5. Jahrhunderts n. Chr.) entstand an diesem Ort eine große landwirtschaftliche Siedlung. Im Jahr 453 n. Chr. verbot Kaiser Theodosius alle heidnischen Aktivitäten. So begann die systematische Zerstörung des Zeus-Tempels. Seine architektonischen Bestandteile wurden für den Bau einer christlichen Basilika verwendet. Die Siedlung wurde dann aber um 580 n. Chr. endgültig aufgegeben.

Überreste des Heroons des Opheltes . © Bild: Wikimedia Commons
Das Heiligtum des Zeus in hellenistischer Zeit

Nach 338 v. Chr. geriet Nemea unter makedonischen Einfluss. (Für 315 v. Chr. ist bezeugt, dass Kassander, einer der wichtigsten Diadochen Alexander des Großen, bei den Spielen in Nemea präsidierte.) Die lebhafte Bautätigkeit dieser Zeit erstreckte sich auf das Stadion, auf den eindrucksvollen Zeus-Tempel (1) samt dazugehörigem Altar (2) und anderen öffentlichen Bauten. Südlich des Tempels befand sich ein künstlich angelegter Hain aus Zypressen. In einem kleinen Haus (3) östlich des Zypressenhains wurden Festbankette im Rahmen des Zeus-Kults veranstaltet. Die Reihe einzelner Gebäude erinnern in Grundriss und Anordnung an die Schatzhäuser (4) von Delphi oder Olympia. Es könnte sich aber auch um Aufenthaltsräume bzw. Repräsentationsräume für die Delegationen auswärtiger Stadtstaaten gehandelt haben. Der dahinterliegende Komplex wird als eine Reihe von Gästehäusern (5) für Athleten und Preisrichter interpretiert. Nur durch eine schmale Straße von diesem Komplex entfernt befindet sich eine Badeanlage (7) mit einem gut erhaltenen Becken und steinernen Waschtrögen. Bei der vom Tempel aus gesehenen dritten Baukomplex dürfte es sich um Wohnhäuser (6) gehandelt haben. In dem von einer Mauer umschlossenen Geviert auf der gegenüberliegenden Seite des damals durch das Gelände fließenden Nemea-Bachs gelegenen Heiligtum (8) wurde Opheltes verehrt.

Die freigelegten Überreste der aus der Zeit um 300 v. Chr. stammenden Badeanlage (7) sind heute durch ein modernes Dach geschützt.
Der nördliche Teil des westlichen Raums des Bades war wahrscheinlich der Ort, an dem die Athleten die Mischung aus Öl, Schweiß und Staub von ihren Körpern abkratzten, bevor sie die Baderäume aufsuchten. Diese wurden von einem Aquädukt mit Wasser versorgt, das von einer Quelle am östlichen Hang des Tals stammte. Das Wasser wurde in ein System von Reservoirs an der Südseite des Bades und von dort in die Baderäume geleitet.

Der östliche Raum des Bades hatte vier Innensäulen, um das Dach zu stützen. Der Sockel einer dieser Säulen ist erhalten, von den anderen drei sind nur noch die Fundamente vorhanden. Die Nutzung des Raums ist nicht bekannt, aber es war wahrscheinlich der Ort, an dem die Athleten ihre Kleidung ablegten und ihren Körper vor dem Training einölten.
Das Stadion
Das antike Stadion von Nemea liegt etwa 450 Meter südöstlich des Zeus-Heiligtums und wurde zwischen 330 und 320 v. Chr. erbaut. Es diente bis 271 v. Chr. als Austragungsort der Nemeischen Spiele, einem der bedeutenden panhellenischen Wettkämpfe der Antike. Das Stadion misst rund 170 Meter in der Länge und etwa 30 Meter in der Breite und bot Platz für mehrere Tausend Zuschauer, die hier spannende sportliche Wettkämpfe verfolgen konnten. Zu den Disziplinen gehörten unter anderem der Stadionlauf in voller Rüstung, Bogenschießen, Boxen, Ringen sowie Diskus- und Speerwurf. Ab der hellenistischen Periode erweiterten sich die Spiele um literarische und musikalische Wettbewerbe, was die kulturelle Bedeutung der Veranstaltung unterstrich. Die Sieger wurden traditionell mit einem Kranz aus Sellerieblättern ausgezeichnet, der als Symbol des Ruhms und der Ehre galt.

In einer Senke östlich des Stadions befinden sich die Überreste eines Peristylhofes mit dorischen Säulen. Dabei handelte es sich wohl um ein „Apodyterion“ (=Umkleideraum), wo sich die Athleten entkleideten und einölten.
Über diesen Umkleideraum gelangte man durch den Tunnel, der durch die Böschung der Zuschauertribüne führt, in das Innere des Stadions.
Der in Keilsteintechnik errichtete Tunnel ist 36 m lang. Heute noch kann man die Graffiti sehen, die die Athleten, die auf den Einzug in das Stadion warteten, in die Steine kritzelten.

Der Großteil der Zuschauer saß auf den dafür errichteten Böschungen. Die Kampfrichter hatten eine Plattform auf der Ostseite des Stadions, von der aus sie die Spiele überwachen konnten.
Die Begrenzung der Stadionsfläche ist samt Wasserkanal weitgehend erhalten geblieben.

Die Startline bestand aus einer Reihe von speziell präparierten Steinen. (Einige davon sind im Museum ausgestellt.) Sie enthielt auch den „hysplex“, ein Startmechanismus, der den gleichzeitigen Start aller Läufer ermöglichen sollte.
BILDNACHWEIS:
- The hero shrine of Opheltes at Nemea. © Bild: Wikimedia Commons
- Hysplex scheme.jpg. Davide Mauro. © Bild: Wikimedia Commons

Suchbegriff bei Google Maps:
Archaelogical site of Nemea
BUCHEMPFEHLUNGEN
- E. Spathari:
Korinthia - Argolis. Esperos (2013)
- Stephen G. Miller: Nemea: A Guide to the Site and Museum. University of California Press (1990)
- Carl von Reifitz: Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Classic Edition (2010)
- Lambert Schneider: DuMont Kunst Reiseführer. DuMont (2011)
- Siegfried Lauffer: Griechenland, Lexikon der historischen Stätten von den Anfängen bis zur Gegenwart. Beck (1994)
- Richard T. Neer: Kunst und Archäologie der griechischen Welt: Von den Anfängen bis zum Hellenismus. Philipp von Zabern (2013)
- Karl-Wilhelm Welwei: Die griechische Frühzeit: 2000 bis 500 v. Chr. Beck'sche Reihe (2019)
- Umberto Pappalardo: Zu Ehren des Zeus: Die Olympischen Spiele der Antike. Philipp von Zabern (2020)
- Judith Swaddling u. Ursula Blank-Sangmeister: Die Olympischen Spiele der Antike. Reclam (2004)
- Karin Kreuzpaintner: Olympia. Mythos, Sport und Spiele in Antike und Gegenwart. Imhof, Petersberg (2012)
- Wolf-Dieter Heilmeyer: Mythos Olympia: Kult und Spiele – Antike. Prestel (2012)
- Rosmarie Günther: Olympia. Kult und Spiele in der Antike. Primus (2004)
- Hans-Volkmar Herrmann: Olympia. Heiligtum und Wettkampfstätte. Hirmer (1972)