Glanum
Glanum bei Saint-Rémy-de-Provence eröffnet Einblicke in eine Siedlungsgeschichte, die von der keltischen Frühzeit des 6. Jahrhunderts v. Chr. bis zur römischen Blüte im 3. Jahrhundert n. Chr. reicht. Zwischen Tempeln, Theater, Thermen und Straßenzügen wird sichtbar, wie keltische, griechische und römische Kultur ineinandergriffen. Die Wahrzeichen „Les Antiques“ – Triumphbogen und Mausoleum – gehören zu den besterhaltenen Bauwerken ihrer Art in Frankreich. Eingebettet in die Landschaft der Alpilles verbindet Glanum archäologische Faszination mit dem besonderen Charme der Provence und macht den Besuch zu einem Spaziergang durch vergangene Welten.

In der Frühen Neuzeit war Glanum weitgehend verschüttet, nur zwei eindrucksvolle Bauwerke ragten sichtbar aus dem Boden: der römische Triumphbogen und das Mausoleum der Julier, die im Volksmund „Les Antiques“ genannt wurden. Diese Monumente weckten das Interesse von Reisenden, Gelehrten und Künstlern – auch wenn Glanum selbst noch nicht freigelegt war. Nachweisbar ist der Besuch König Karls IX. im Jahr 1564 während seiner „Grand tour de France“. Im 17. Jahrhundert dokumentierte der provenzalische Humanist Nicolas-Claude Fabri de Peiresc die Bauwerke in Zeichnungen und Beschreibungen, die europaweit kursierten. Während der eigentlichen europäischen „Grand Tour“ ab dem 18. Jahrhundert machten einige gebildete Reisende Station in Saint-Rémy. Der spätere Louis XVIII., damals noch Comte de Provence, besuchte 1777 die Stätte und veranlasste Schutzmaßnahmen am Triumphbogen, zumindest ist das in lokalen Quellen so bezeugt.

Die Salluvier, ein keltisch-ligurisches Mischvolk, das zu den mächtigsten Stämmen Galliens zählte, errichteten ab dem 4. Jh. v. Chr. beim Mont Gaussier ein Oppidum, das sie mit einer Trockenmauer umgaben, welche den Pass durch die Alpillen sperrte. An einer dort befindlichen Quelle, die für ihre Heilkräfte bekannt war, wurde ein Schrein für den Gott Glanis errichtet, der mit dieser in Verbindung gebracht wird. Die Verehrung dieses Gottes in der Nähe des Wassers begünstigte die Entwicklung der Siedlung.

Die Heilige Quelle: Ein ursprünglich einfaches, in den Fels gehauenes Becken wurde im 2. Jh. v. Chr. mit einem Gebäude überbaut. Die Römer, die die Verehrung dieses Wassergottes beibehielten, errichteten dann zu beiden Seiten der Quelle ein Herkules-Heiligtum und einen Valetudo-Tempel.
Im Rahmen der archäologischen Ausgrabungen, die Anfang des 20. Jahrhunderts begannen und bis heute andauern, konnten auch einige Wohnhäuser aus gallischer Zeit freigelegt werden.

Diese eng aneinander gereihten Häuser, die beiderseits einer Durchgangsstraße teilweise in den Fels gebaut wurden, bestanden in der Regel aus zwei Räumen.
Die Einwohner von Glanum standen bereits sehr früh in Kontakt mit der griechischen Kolonie Massalia, dem heutigen Marseille, deren Gründung etwa 600 v. Chr. erfolgte. Die daraus resultierenden griechischen Einflüsse manifestierten sich in einer gewissen „Hellenisierung“ der Architektur, die sich beispielsweise in der Verwendung großflächiger Steinmetzarbeiten an der Quelle und an der Stadtmauer, im Bau neuer Gebäude im griechischen Stil, wie Privatvillen und einem Bouleuterion, äußerten. Das herausragendste Beispiel war zweifelsohne der Bau eines monumentalen Zentrums im griechischen Stil. Die Stadt, die sich in der Zeit über eine Fläche von etwa 20 Hektar erstreckte, wurde durch eine Ringmauer geschützt.
Im 2. Jh. v. Chr. kam es zu Konflikten zwischen den Salluviern und den Griechen von Marseille, die über keine starke Armee verfügten und daher die Unterstützung ihrer römischen Verbündeten in Anspruch nahmen. Im Jahr 125 v. Chr. wurden dann die keltischen Salluvier von der Armee des römischen Konsuls Marcus Fulvius Flaccus besiegt. Im Zuge dieser kriegerischen Auseinandersetzungen kam es auch zur teilweisen Zerstörung von Glanum.
Im Jahr 49 v. Chr. eroberte Julius Cäsar Marseille und leitete damit die Romanisierung der Provence ein. Die Stadt Glanum profitierte davon in erheblichem Maße. In zwei Bauphasen wandelte man die griechische Agora in ein römisches Forum um. In der Folgezeit entstanden Thermen, Tempel, eine Basilika sowie eine Curia. Kaiser Augustus, dessen Schwiegersohn Agrippa sich sogar in Glanum aufgehalten haben soll, erhob die Stadt sogar in den Rang einer römischen Colonia. Vermutlich zu dieser Zeit wurde auch ein Staudamm und ein Aquädukt, die die Stadt mit Wasser versorgten, und eine Kanalisation gebaut, die auch für den Regenwasserabfluss in dem engen Tal sorgte.

Um das Jahr 10 n. Chr. begannen außerhalb der Stadt, an der Via Domitia, die Spanien und Italien auf dem Landweg miteinander verband, die Arbeiten an einem Triumphbogen. Das Mausoleum, welches sich neben dem Triumphbogen befindet, wurde bereits einige Jahrzehnte zuvor errichtet, um Angehörigen der Familie Julii zu gedenken. Es wird angenommen, dass sich ein Mitglied dieser Familie nach der Eroberung Galliens durch Julius Cäsar in den Diensten der römischen Armee verdient gemacht hatte und daraufhin von Cäsar mit dem Bürgerrecht sowie dem Recht, den Namen seines eigenen Geschlechts tragen zu dürfen, ausgezeichnet wurde.
Im Jahr 260 n. Chr. zerstörten die Alemannen die Stadt. Ihre Bewohner gründeten etwas nördlich in der Ebene eine neue Stadt, aus der schließlich das heutige Saint-Rémy-de-Provence werden sollte. Die ursprüngliche Stadt um die heilige Quelle wurde über einen längeren Zeitraum als Lieferant für Steine, die man zum Bau von Saint-Rémy benötigte, missbraucht, bis das römische Abwassersystem aufgrund der Überbeanspruchung zusammenbrach und Schlamm und Sedimente die Ruinen bedeckten.
Die zwei berühmten, außerordentlich gut erhaltenen antiken Monumente vor der ehemaligen Stadtmauer befinden sich an der Straße, die von Saint-Rémy-de-Provence zur Archäologischen Stätte Glanum führt und sind frei zugänglich.

Die „Antiques“ im Jahr 1792. Bild: © Wikimedia Commons
Der Triumphbogen von Glanum
Der eindrucksvolle 12,5 m lange und 5,5 m breite Bogen von Glanum wird aufgrund einiger architektonischer Details in das Jahrzehnt zwischen 10 und 20 n. Chr. datiert. Dieses weithin sichtbare Symbol römischer Macht und Autorität zeigt gallische Gefangene, die von den siegreichen Römern in Ketten abgeführt werden. Der fehlende obere Teil wurde im 18. Jh. als Satteldach umgestaltet und mit Steinplatten abgedeckt, was ihm eine etwas eigenartige Form verleiht.
Das Mausoleum der Julier
Das Mausoleum, das sich in unmittelbarer Nähe zum Triumphbogen ebenfalls außerhalb des ehemaligen Stadtgebietes befindet, stammt aus der Zeit um 40 v. Chr. Das 18 m hohe Monument ist eines der am besten erhaltenen Mausoleen der Römerzeit. Es wird angenommen, dass es sich dabei um eine Grabstätte handelt, die drei Brüder mit dem Namen Julius für ihre Eltern errichten ließen.

Der unterste Teil des Monuments (Piedestal) ist mit Girlanden, Theatermasken, Putten sowie mit mythischen oder sagenumwobenen Szenen geschmückt.
Auf diesem Unterbau erhebt sich ein vierfacher Torbogen, der an einen Triumphbogen erinnert. Der Fries an der Spitze dieses Quadrifons ist mit Tritonen, die die Sonnenscheibe tragen, und mit Seeungeheuern verziert.

Bekrönt wird das Bauwerk von einer Struktur, die an einen Monopteros erinnert. In diesem Rundbau sind zwei Statuen aufgestellt, die vermutlich den Vater und den Großvater der Julier darstellen sollen. Das konische Dach ist mit Fischschuppen verziert, wie es für römische Mausoleen traditionell ist.


Der nördliche Teil von Glanum war das Wohnviertel mit Villen und ausgedehnten öffentlichen Bädern. Die Bäder, die zur Romanisierung der örtlichen Bevölkerung einen erheblichen Beitrag leisteten, waren das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens.
Die Hauptstraße durchquerte die Stadt von Norden nach Süden. Auf der linken Seite befanden sich die Thermen (1) und die Kurie (2), auf der rechten Seite der Markt (3). Die breiten Platten (4) auf der Straße verdeckten das Abwassersystem und die Frischwasserkanäle. Die Abwasserkanäle leiteten die Abwässer und das Regenwasser nach außerhalb der Stadt ab. Der kleinere Frischwasserdurchlass (5) verläuft auf seiner gesamten Länge parallel zur Kanalisation.

Das Haus mit Anten
Dieses zweistöckige Privathaus, das nach geriffelten Anten, die seinen Eingang flankierten, benannt ist, wurde im hellenistischen Stil erbaut.
Die Wohnräume öffneten sich zu einem von Säulengängen gesäumten Hof (1) - mit einem wenige Zentimeter tiefen Becken in der Mitte, das zum Sammeln von Regenwasser, dem Impluvium (2), diente. Der Überlauf floss in ein darunter liegendes Becken (3), das seinerseits zur Reinigung der Latrinen (5) abfloss (4). Ein Raum (6) wurde durch zwei Antae, Eckpfeiler am Ende der Wände, die mit korinthischen Kapitellen verziert waren, aufgewertet.

Das Haus des Attis

In römischer Zeit scheint dieses Haus als Wohnsitz für die Priester von Attis gedient zu haben. Ein Marmorrelief dieses Gottes, das hier gefunden wurde, ist heute im archäologischen Museum in Saint-Rémy-de-Provence zu sehen.

Mehrere Jahrhunderte lang behielt dieses Haus seine Außenmauern, doch die Innenausstattung wurde mehrfach verändert. So wurde in römischer Zeit eine Küche mit einem Brunnen und einer Umfassungsmauer (1) hinzugefügt. Diese Ausstattung und die Qualität der Schwellen (2), (3), (4) verdeutlichen den Reichtum dieses Hauses.

Die römischen Thermen
Die Überreste der um ca. 40 v. Chr. errichteten und im 2. Jh. n. Chr. erweiterten Thermen befinden sich auf der östlichen Seite der Hauptstraße. Der ältere Teil der Anlage bestand aus dem Caldarium (5), dem Tepidarium (4) und dem Frigidarium (3). Die lauwarmen und heißen Bäder wurden von der Befeuerungsstelle (Praefurnium) (6) aus beheizt. Die erzeugte heiße Luft zirkulierte unter den Böden zwischen den gemauerten Pfeilern. Der Erweiterungsbau umfasste den Haupteingang, ein Schwimmbecken und eine Palästra (2). Das Wasser für das Schwimmbecken wurde durch die Öffnung einer steinernen Theatermaske geleitet. Das Original dieser Maske befindet sich jetzt im nahegelegenen Museum in Saint-Rémy-de-Provence.


Die Curia
Auf dem Weg zum Forum kommt man an den Resten eines großen Gebäudes mit einer ziemlich gut erhaltenen Apsis vorbei, in dem die Curia tagte und Recht gesprochen wurde.
Das monumentale Zentrum der Stadt

Der heilige Brunnen
Der im 2. Jh. v. Chr. gebaute Brunnen hat einen Durchmesser von drei Metern und verfügt über eine Treppe mit siebenunddreißig Stufen, die zum Wasser hinabführt.
Die Zwillingstempel
Die zwei im Stil identischen korinthischen Tempel, die an drei Seiten von Kolonnaden umgeben waren, wurden um 20 v. Chr. errichtet, etwa zu der Zeit, als Glanum den Titel oppidum latinum erhielt. Eine Ecke des kleineren der beiden Tempel, drei Säulen sowie einige Elemente des Gebälks und der Fassade im Stil der frühen Regierungsjahre von Kaiser Augustus wurden rekonstruiert, um eine Vorstellung von den Proportionen des Tempels zu vermitteln.
Der Triumphbrunnen
Am südlichen Ende des Forums befand sich ein monumentaler Brunnen aus der Zeit um 20 v. Chr. Das rechteckige Becken des Brunnens schloss mit einer halbkreisförmigen Apsis unter einer Nische ab. Sowohl in der Nische als auch am Beckenrand dürften sich Figuren mit eindeutiger Triumphsymbolik befunden haben: Gallische Gefangene auf den Knien (3) und Trophäen (4). Die Wasserversorgung des Brunnens erfolgte über Bleirohre (5).


Das Stadttor
Das Tal der Heiligen Quelle wurde durch eine Steinmauer abgeschlossen, die im späten 2. oder frühen 1. Jh. v. Chr. errichtet wurde. Diese Mauer hatte ein Tor, das groß genug für Streitwagen war, einen quadratischen Turm und ein kleineres Tor für Fußgänger.

Ab der hellenistischen Epoche, als die Stadt über die Stadtmauern hinaus wuchs, dienten sie nicht mehr der Verteidigung, sondern hatten eine Gedenk- und Denkmalfunktion und markierten die physische Trennung zwischen den neuen Stadtvierteln und dem alten einheimischen Stadtkern mit dem Bereich der heiligen Quelle. Links und rechts vom Tor befinden sich Überreste der älteren Mauern aus dem 6. bis 3. Jh. v. Chr., die einen 16 Meter hohen Wall bildeten.
Die Heilige Quelle
Die heilige Quelle von Glanum befindet sich im südlichen und höchsten Teil der Stadt.

Links ein kleiner Tempel, den Marcus Agrippa vermutlich 39 v. Chr. der römischen Göttin der Gesundheit Valetudo weihte. In der Mitte die Heilige Quelle und rechts ein Tempel, der Herkules, dem Hüter der Quellen, gewidmet war. Hier fanden die Ausgräber sechs Altäre für Herkules und den Torso einer großen Herkulesstatue, die eine Vase mit Wasser hielt, offenbar das Wasser der Glanum-Quelle.
Die Quelle und ihre Heilkräfte waren die Grundlage für den Ruf und Reichtum der Stadt. Ursprünglich war es ein in den Fels gehauenes Becken. Im 2. Jh. v. Chr. wurde über diesem dann ein Steingebäude mit einer dekorativen Fassade errichtet.
Der Valetudo-Tempel
Bildnachweis:
- Die „Antiques“ im Jahr 1792. Bild: © Wikimedia Commons
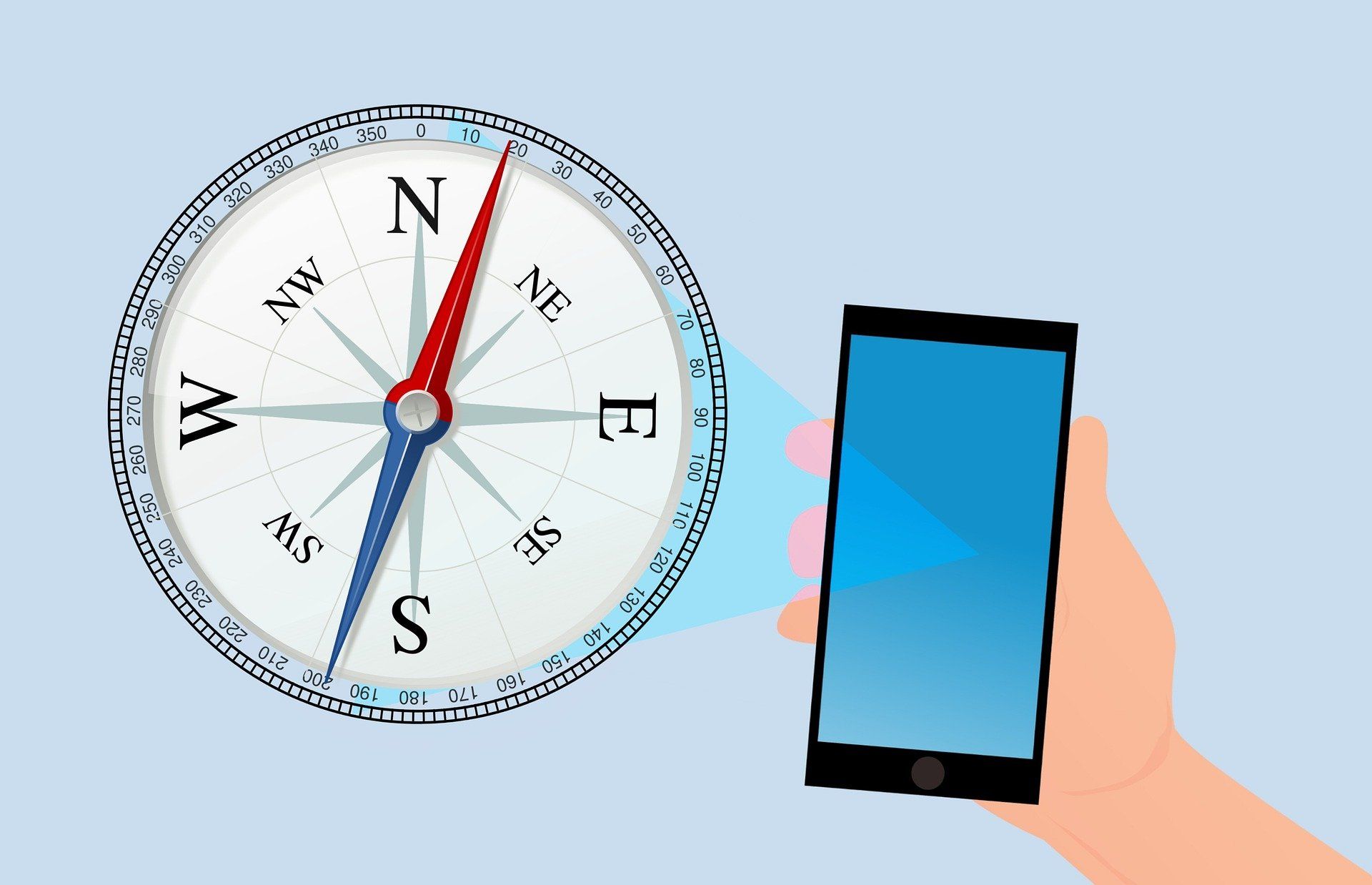
Suchbegriff bei Google Maps:
Site Archéologique de Glanum
BUCHEMPFEHLUNGEN
- Peter Brannath: Der Aquädukt. Die Geschichte vom Bau des Aquädukts von Ucetia (Uzès) nach Nemausus (Nîmes) und seinem berühmten Teilstück, dem Pont du Gard. Schillinger (2011)
- Pierre Gros: Gallia Narbonensis: Eine römische Provinz in Südfrankreich. Zabern (2008)
- Anne Roth-Congès: Glanum. Vom kelto-ligurischen Oppidum zur gallo-römischen Stadt. Éditions du patrimoine (2012)
- Raymond Chevallier: Römische Provence: die Provinz Gallia Narbonensis. Atlantis (1979)
- Helga Botermann: Wie aus Galliern Römer wurden. Leben im Römischen Reich. Klett-Cotta (2005)
- Bert Freyberger: Südgallien im 1. Jahrhundert v. Chr. Phasen, Konsequenzen und Grenzen römischer Eroberung. Steiner (1999)
- Thorsten Droste: DuMont Kunst Reiseführer Provence: Antike Arenen, romanische Kreuzgänge, Städte mit Geschichte. Eine Reise durch Frankreichs Sonnenprovinz (2011)
- Ulrike Klugmann: HB Kunstführer, Nr.36
- Edwin Mullins: Roman Provence: A History and Guide. Signal Books (2011)
- James Bromwich: The Roman Remains of Southern France: Routledge (1996)
- Meike Droste: Arles: Gallula Roma - Das Rom Galliens. Zabern (2003)

