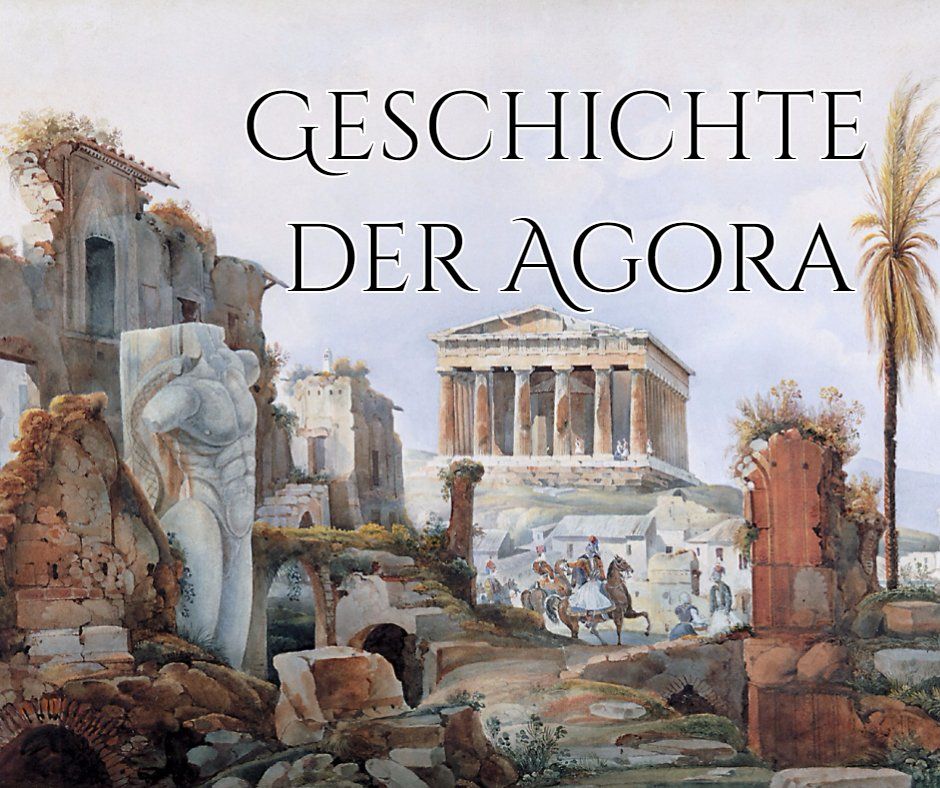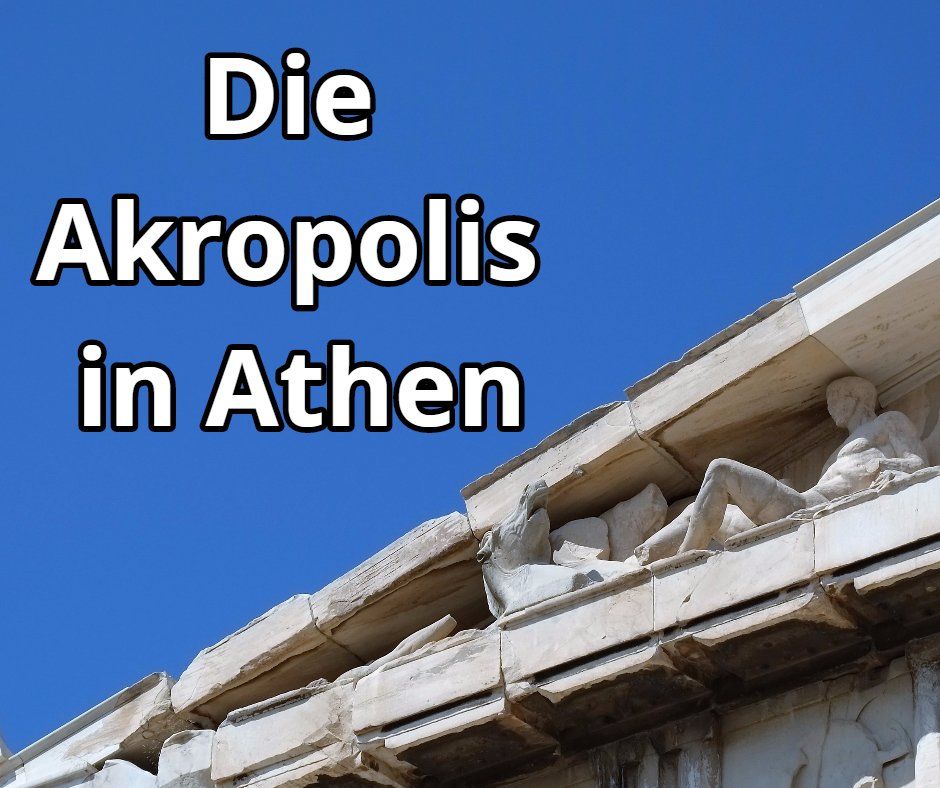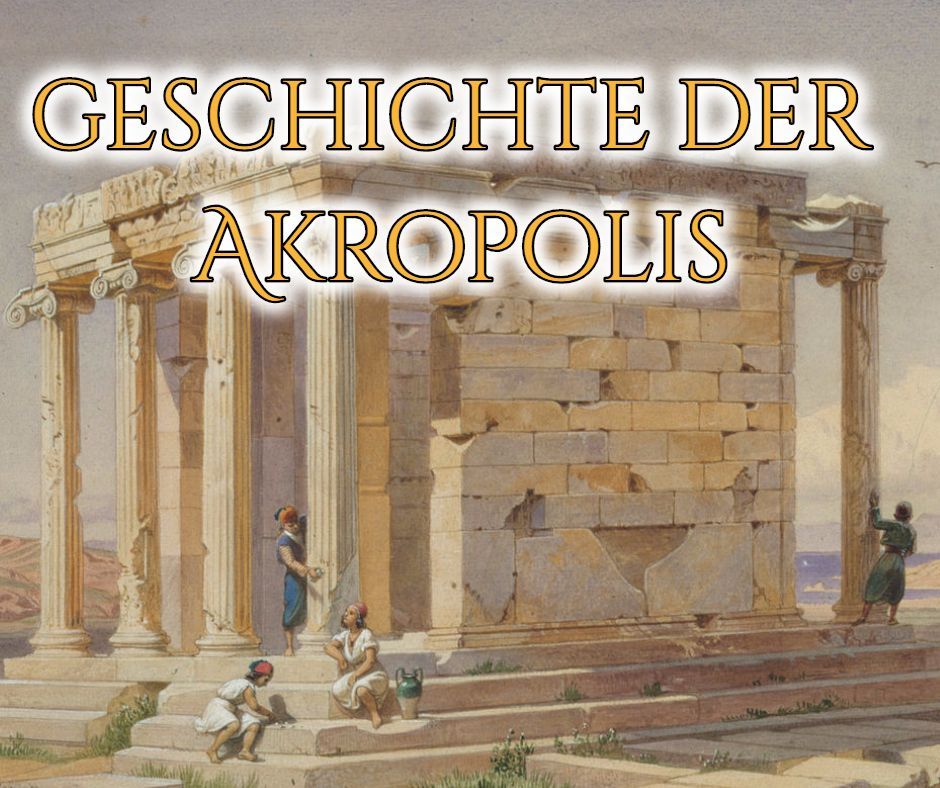Das Pompeion, das Dipylon und das Heilige Tor

Das klassische Pompeion zwischen dem Heiligen Tor (links) und dem Dipylon, dem Haupttor des antiken Athen. Ursprünglich nannte man die beiden gewaltigen Toranlagen, durch die die Straßen in die Thriasische Ebene führten, „Thriasische Tore“. Aus einer Urkunde aus dem 3. Jh. v. Chr. ist für die größere Toranlage der Name „Dipylon“ überliefert. Für die kleinere, heute als „Heiliges Tor“ bekannte Anlage ist vor dem 2. Jh. n. Chr. kein eigener Name bezeugt. Beide Toranlagen wurden tief hinter die Stadtmauer zurückversetzt. Die langen, von Wehrgängen bekrönten Schenkelmauern bildeten somit jeweils einen Vorhof, der in Friedenszeiten von Bürgern und Reisenden als beliebter Treffpunkt und Schauplatz von Versammlungen und diverser kultischer Aktivitäten genutzt werden konnte. Im Krieg jedoch verwandelten sich diese Räume für die Angreifer, die bei der Durchquerung dem allseitigen Beschuss ausgesetzt waren, zu sackartigen Fallen. Durch das Heilige Tor führte die Straße zum Mysterienheiligtum von Eleusis. Die Straße, die durch das Dipylon zum Hain des attischen Heros Akademos bzw. zur Platonischen Akademie führte, war vor dem Tor mehr als 40 Meter breit. Sie hatte nicht nur als Verkehrsachse, sondern auch als Austragungsort kultischer Veranstaltungen außergewöhnliche Bedeutung. © Bild: Dimitrios Tsalkanis & Chrysanthos Kanellopoulos: ancientathens3d.com

Die nach den Perserkriegen von Themistokles errichtete Stadtmauer war bis zu 10 m hoch, 3 m breit und hatte eine Gesamtlänge von 6, 5 km. Von den 13 Stadttoren, die die Zugänge zu der antiken Stadt ermöglichten, waren die beiden im Demos Kerameikos gelegenen mit Abstand die wichtigsten. Diesem themistokleischen Mauerring vorgelagert war eine als Proteichisma (Vorwerk) bezeichnete Befestigungsanlage, deren Aufgabe es war, Belagerungsmaschinen von der Stadtmauer fernzuhalten. Zusätzlichen Schutz bot ein davor angelegter Stadtgraben. Die Erbauung des Vorwerks und der Stadtgräben erfolgte frühestens während des Peloponnesischen Krieges, vielleicht zugleich mit der Erneuerung der Stadtmauer nach dem Erdbeben von 420 v. Chr. Im Umfeld der Tore herrschte rege Betriebsamkeit. Händler trafen ein, brachen zu Reisen auf oder errichteten Stände, auf denen sie ihre Waren feilboten. Prozessionen zogen an festgelegten Tagen von hier zu innerhalb und außerhalb der Stadt gelegenen Heiligtümern. Leichenzüge und Frauen, die die Gräber pflegten, waren zur Nekropole, die außerhalb der Tore angelegt war, unterwegs. Das Areal um die Tore war außerdem ein beliebter Ort, an dem sich Prostituierte mit ihren Kunden trafen. Angeblich soll sich hier auch der Philosoph Diogenes gerne aufgehalten haben. © Bild: Dimitrios Tsalkanis: ancientathens3d.com
Für den Besucher des Archäologischen Parks (Archaeological Site and Museum of Kerameikos), in dem man heute die Überreste der beiden Stadttore und des Pompeions besichtigen kann, ist es allerdings nicht ganz so leicht, sich einen Überblick zu verschaffen. Schließlich sind ja die spärlichen Reste, die vom klassischen Pompeion übrig geblieben sind, von den Ruinen des aus der Zeit des römischen Kaisers Antoninus Pius stammenden Magazinbaus überlagert. Außerdem wurden im 4. oder 5. Jh. n. Chr. über den beiden Schichten noch zwei sich gegenüberliegende Stoen errichtet, deren Fundamente noch teilweise sichtbar sind.
Das Dipylon (Zweifach- oder Doppeltor), das zusammen mit dem benachbarten Heiligen Tor 478 v. Chr. als Teil der Befestigung Athens durch Themistokles nach den Perserkriegen errichtet wurde, bedeckte eine Fläche von ca. 1.800 qm. Es wurde aus dem Verlauf der Stadtmauer zur Stadtseite hinein versetzt und durch zwei Schenkelmauern, auf denen sich Wehrgänge befanden, mit dieser verbunden. Der so entstandene Raum wurde durch vier Wehrtürme abgesichert. Die gewaltigen Dimensionen erklären sich hauptsächlich dadurch, dass hier – innerhalb und außerhalb des Athener Haupttores – zahlreiche kultische und repräsentative Handlungen und Aktivitäten vollzogen wurden.

Die stadteinwärtige Ansicht des Dipylons: Neben den beiden Doppeltoren konnte man in einem eigens dafür eingerichteten Brunnenhaus (rechts) seinen Durst löschen. Zwischen dem Dipylon und dem noch westlicher gelegenen Heiligen Tor befand sich das Propylon zum Pompeion. Der ursprünglich ganz aus Marmor errichtete Torbau besaß vier ionische Frontsäulen, die ein marmornes Giebeldach stützten. Drei zweiflügelige Türen, von denen die mittlere den Wagen vorbehalten war, öffneten sich zum Innenhof, in dem auch das vom Panathenäenfestzug mitgeführte Schiff gestanden haben könnte.

© Bild: Wikimedia Commons
Das der Stadtgöttin Athene gewidmete Panathenäenfest war das größte religiös-politische Fest im antiken Athen. Seit 566 v. Chr. wurde die jährlich stattfindende Festivität in jedem vierten Jahr besonders prächtig und aufwändig gestaltet. Bei all den Aktivitäten, die im Rahmen des Festes unternommen wurden, spielte das Gebiet um das Pompeion eine bedeutende Rolle. Dabei lassen sich drei Hauptaspekte nennen:
- Der feierliche Umzug, an dem die gesamte athenische Bürgerschaft beteiligt war, nahm beim Dipylon seinen Ausgang und führte über die Agora bis zur Akropolis. Das prächtigste Schaustück bei der Prozession war zweifellos ein hölzernes Schiff mit Rädern, auf dem das safranfärbige Obergewand (Peplos) der Göttin mitgeführt wurde, das athenische Frauen in monatelanger Handarbeit gefertigt und reich verziert hatten. Das ganze Jahr über wurde dieses Schiff mit großer Wahrscheinlichkeit im Innenhof des Pompeions aufbewahrt.
- Die Hekatombe, das Opfer von einhundert Rindern, bei der das Fleisch der Tiere zu Ehren der Göttin verzehrt wurde, stellte auch eine der raren Möglichkeiten zum Fleischkonsum für den ärmeren Teil der Bevölkerung dar. Es kann davon ausgegangen werden, dass meist die Einnahme des Festopfers – unter Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen – im Vorhof des Dipylons stattfand.
- Wie bei den meisten antiken Festen waren auch bei den Panathenäen diverse Wettkämpfe Teil des Veranstaltungsprogramms. Das lässt sich sehr gut anhand der zahlreich gefundenen panathenäischen Preisamphoren belegen, auf denen sich stets auch die Abbildung des entsprechenden Wettkampfes findet. Diese Wettkämpfe fanden in dem außerhalb der beiden Tore gelegenen Areal, vor allem vor dem Dipylon, statt.
Dem themistokleischen Mauerring war eine als Proteichisma (Vorwerk) bezeichnete Befestigungsanlage sowie ein Grabenbecken vorgelagert. Einige Teile dieser einst hohen Mauer aus Quaderblöcken sind noch heute erkennbar. Der Graben ist natürlich schon eingeebnet. Die Erbauung von Proteichisma und Stadtgräben erfolgte frühestens während des Peloponnesischen Krieges. Einige Teile der Anlage sind nachweislich unter dem Feldherren Konon (444 v. Chr. – 390 v. Chr.) entstanden.
Der vollständig erhalten gebliebene Boden des Brunnenhauses stammt aus der Zeit um 307 – 304 v. Chr. Bis auf einen Quader in der Nordwestecke und den marmornen Säulenbasen ist vom aufgehenden Mauerwerk nichts mehr übrig geblieben.
Man betrat das Pompeion durch eine monumentale Toranlage (Propylon), von dem sich der Fußboden aus Marmorplatten teilweise erhalten hat. Ursprünglich besaß das aus Marmor bestehende Propylon vier ionische Frontsäulen, die ein Giebeldach stützten. Drei Türen, von denen die mittlere den Wagen vorbehalten war, öffneten sich in den von Säulen umgebenen Hof des Pompeions.
Das Pompeion: Bereits gegen Ende des 5. Jhs. v. Chr. wurde an der Stelle ein erster Bau errichtet. Damals umgaben wahrscheinlich Holzsäulen einen 45 x 17 m großen Hof. Kurz nach 400 v. Chr. wurde aber, noch bevor dieser erste Bau vollendet werden konnte, der Plan geändert und erweitert. Den Eingang zu dem nun vergrößerten Innenhof, der von 6 x 13 unkannelierten Porossäulen (deren zahlreiche Stümpfe sich noch in situ befinden) umgeben war, bildete die aus Marmor bestehende Toranlage. An der West- und der Nordseite des Innenhofes öffneten sich Türen zu mehreren quadratischen Räumen unterschiedlicher Größe mit Fußböden aus weißen Kieseln. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um Bankett- und Wirtschaftsräume, die wohl für die Vorbereitung und Durchführung der Panathenäen benötigt wurden. Hier fand man auch die Reste von an die Wand gelehnten Prunkbetten (Klinen), die bei Symposien gebräuchlich waren. Insgesamt boten diese Banketträume Platz für 66 Klinen. Hauptsächlich diente das Pompeion dem Panathenäenfest, es dürfte aber auch als Gymnasium genutzt worden sein, worauf Inschriften von Epheben an der Innenseite des Peristylhofes hinweisen. Offenbar hatte jedermann Zutritt zum Pompeion. Einer späteren Überlieferung zufolge soll sich deswegen der Philosoph Diogenes hier gerne aufgehalten haben. Inschriften und andere Quellen legen auch nahe, dass an den Wänden der Säulenhallen Gemälde von berühmten Persönlichkeiten angebracht waren. Den jungen Epheben, die hier ausgebildet wurden, sollten mit Hilfe solcher Bilddenkmäler vorbildhaftes Verhalten näher gebracht werden. Belegt ist, dass hier eine, vom Bildhauer Lysipp hergestellte Bronzestatue des Sokrates aufgestellt war. Im Jahr 86 v. Chr. wurde das Pompeion von den Truppen des römischen Feldherren Sulla vollständig zerstört. Etwa zweihundert Jahre lang standen dann zwischen den beiden Toren Werkstätten von Handwerken und die Öfen der Töpfer, die dem Stadtviertel den Namen gaben. Von Pausanias (um 115 bis um 180 n. Chr.) wissen wir, dass sich an der Stelle im 2. Jh. n. Chr. dann ein dreischiffiger, zweistöckiger Magazinbau befunden haben muss. Der Erhaltungszustand der dazugehörigen Gebäudeteile ist aber so schlecht, dass die darauf Rekonstruktion des Aussehens dieses Gebäudes letztlich hypothetisch bleiben muss. In der ersten Hälfte des 5. Jhs. n. Chr. entstanden dann noch zwei sich gegenüberliegende lange Stoen, die von einer Straße getrennte waren. Zu ihnen gelangte man durch ein monumentales Festtor mit drei Durchgängen. Von diesem Bauwerk ist aber außer den Fundamenten der äußern Nordwand so gut wie nichts mehr zu sehen.

Das Heilige Tor, das nur 42 m vom Dipylon entfernt ist, gehört ebenfalls zum Typus des nach außen hin offenen Hoftores. An dieser Stelle verließ der Eridanos (der einzige im Inneren der Stadtmauern fließende Bach) das Stadtareal. Von hier nahm die Heilige Straße ihren Ausgang, auf der die Prozessionen, die zum Mysterienheiligtum der Demeter nach Eleusis zogen.
BILDNACHWEIS:
- Aerial view of the Pompeion. On the left, the Sacred Gate and on the right the Dipylon. © Bild: Dimitrios Tsalkanis & Chrysanthos Kanellopoulos: ancientathens3d.com
- The area of Kerameikos (Outer) from west. The city walls can be seen with the two main gates: The Dipylon and the Sacred Gate. In the background, the Acropolis. © Bild: Dimitrios Tsalkanis: ancientathens3d.com
- Panathenaic amphora, c. 530 BCE. Terracotta, H. 62,2 cm. Footrace, obverse : Athena. Attributed to Euphiletos Painter. The Met, accession number 14.130.12. © Bild: Wikimedia Commons

Suchbegriff bei Google Maps:
Kerameikos Athen
- Patrick Schollmeyer: Die 40 bekanntesten archäologischen Stätten in Athen und Attika. Nünnerich-Asmus (2019)
- Ancient Agora of Athens – Areopagus Hill. Brief history and tour. Publication of the Association of Friends of the Acropolis. (2004)
- Ulrich Sinn: Athen – Geschichte und Archäologie. Beck (2004)
- Karl W. Welwei: Das klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert. WBG (1999)
- Karl W. Welwei: Athen. Vom neolithischen Siedlungsplatz zur archaischen Großpolis: Vom neolithischen Siedlungsplatz zur archaischen Grosspolis. WBG (2001)
- Heiner Knell: Vom Parthenon zum Pantheon- Meilensteine antiker Architektur: Meilensteine der antiken Architektur. Philipp von Zabern (2013)
- Heiner Knell: Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. - eine Stadt verändert ihr Gesicht: Archäologisch-kulturgeschichtliche Betrachtungen. WBG (2000)
- Christian Meier: Athen: Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Pantheon (2012)
- Christian Habicht: Athen: Die Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit. Beck (1995)
- Jutta Stroszeck u. Andrea Schellinger: »... in einer Ruhe die wundernimmt«: Der Kerameikos in literarischen Zeugnissen von 1863 bis heute. Kadmos (2017)
- Jutta Stroszek: Der Kerameikos in Athen: Geschichte, Bauten und Denkmäler im archäologischen Park. Bibliopolis (2014)
- Renate Tölle-Kastenbein: Das archaische Wasserleitungsnetz für Athen und seine späteren Bauphasen. WBG (1994)
- Renate Tölle-Kastenbein: Das Olympeion in Athen. Böhlau (1994)
- Gottfried Gruben u.a.: Die Heiligtümer und Tempel der Griechen. Hirmer (2001)
- Savas Gogos u.a.: Das Dionysostheater von Athen: Architektonische Gestalt und Funktion. Phoibos (2008)
- Emil Reisch und Wilhelm Dörpfeld: Das griechische Theater: Beiträge zur Geschichte des Dionysostheaters in Athen und anderer griechischer Theater. Hansebooks (2019)
- Adolf Boetticher: Die Akropolis von Athen. Springer (2013)
- Christoph Höcker und Lambert Schneider: Die Akropolis von Athen: Eine Kunst- und Kulturgeschichte. WBG (2001)
- John McK. Camp II u. Craig A. Mauzy (Hrsg.): Die Agora von Athen: Neue Perspektiven für eine archäologische Stätte. Philipp von Zabern (2009)
- Hans Rupprecht Goette u. Jürgen Hammerstaedt: Das antike Athen: Ein literarischer Stadtführer. C.H.Beck (2012)
- Klaus Gallas: Reclams Städteführer Athen: Architektur und Kunst (2019)
- Peter Connolly u. Hazel Dodge: Die antike Stadt. Das Leben in Athen und Rom. Könemann (1998)
- Frank Börner: Die bauliche Entwicklung Athens als Handelsplatz in archaischer und klassischer Zeit (Quellen und Forschungen zur Antiken Welt). Tuduv (1996)
- Heiner Knell: Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. - eine Stadt verändert ihr Gesicht. WBG (2000)
- Frank Kolb: Agora und Theater, Volks- und Festversammlung - Archäologische Forschungen, Band 9. (1981)
- Christian Meier: Athen: Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Pantheon (2012)
- Leonhard Burckhardt u. Jürgen Ungern-Sternberg (Hrsg.): Große Prozesse im antiken Athen. C.H.Beck (2000)
- Peter Funke: Athen in klassischer Zeit (Beck'sche Reihe 2074). C.H.Beck (2019)
- Dorothy B. Thompson: An Ancient Shopping Center (Agora Picture Book 12). American School of Classical Studies at Athens (2001)
- Laura Gawlinski: Athenian Agora (Museum Guides). American School of Classical Studies at Athens (2014)
- Susan I. Rotroff , Robert D. Lamberton: Women in the Athenian Agora (Agora Picture Book, Band 26). American School of Classical Studies at Athens (2006)
- Alison Frantz: The Middle Ages in the Athenian Agora (Agora Picture Book 7). American School of Classical Studies (1961)
- Wilfried Nippel: Antike oder moderne Freiheit: Die Begründung der Demokratie in Athen und in der Neuzeit. Fischer (2008)
- Karl-Wilhelm Welwei: Das Klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert. Primus (2001)